Das Quantenjahr 2025 in Deutschland ist gestartet
Am 14. Januar 2025, zugleich auch dem 180. Geburtstag der DPG, starteten die Aktivitäten des Quantenjahrs in Deutschland mit einer öffentlichen Veranstaltung an der Humboldt-Universität zu Berlin. Rund 450 Teilnehmende waren vor Ort, fast 400 weitere im Livestream.
DPG-Präsident Klaus Richter lenkte dabei den Blick insbesondere auf Physiker:innen unterschiedlichster Länder, die die Entwicklung der Quantenphysik in den Jahren ab 1925 maßgeblich geprägt haben, und betonte: „Die Erweiterung der klassischen Mechanik hin zur Quantenmechanik war sicher kein Quantensprung, denn Quantensprünge sind sehr, sehr klein, sondern ein wahrer Erkenntnis-Sprung: Die Art, wie hier wissenschaftliches Neuland betreten und gewonnen wurde, war schlichtweg revolutionär.“. Zudem gab er einen Ausblick auf die Quantenaktivitäten in Deutschland und eine Auswahl bevorstehender Veranstaltungen für die Öffentlichkeit.
Christoph Schneider, Vizepräsident für Forschung der Humboldt-Universität zu Berlin, stellte das Netzwerk der bestehenden Quantenforschung in Berlin vor. „In einem hochkomplexen Feld wie der Quantenforschung sind Zusammenarbeit und der Austausch von Ideen der Schlüssel zum Erfolg. Die Quantenmechanik hat uns gelehrt, dass die Welt komplexer und vielschichtiger ist, als wir es uns oft vorstellen und es immer noch viel zu entdecken und zu verstehen gibt. Das Quantenjahr 2025 ist eine Gelegenheit, die Errungenschaften der Vergangenheit zu feiern und den Blick auf die Zukunft zu richten – und es ist eine Einladung an alle, sich mit den faszinierenden Konzepten der Quantenmechanik auseinanderzusetzen.“
Im Anschluss gab Wolfgang Ketterle, Nobelpreisträger für Physik, einen Einblick in die eindrucksvolle Entwicklung der Quantenmechanik. „Experimente an einzelnen Photonen, das hätte Schrödinger für unmöglich gehalten. Nun ist es eine große Errungenschaft der Quantenwissenschaften, dass wir es geschafft haben, Experimente an einzelnen Photonen zu machen, an einzelnen Atomen und auch die Atome in einem einzelnen Quantenzustand zu haben“. Als weiteres Beispiel erklärte er die Unterschiede zwischen früheren analogen Rechnern und der heutigen Entwicklung zu Quantencomputern und erläuterte deren auf QuBits basierender Funktionsweise – am Beispiel von roten und blauen Socken.
Daran knüpfte die anschließende Podiumsdiskussion an. Es wurde erörtert, dass die Quantenphysik sich auf kleinster Skala abspielt: Im Alltag sehe man keine einzelnen Atome, weshalb die Gesetze der Quantenmechanik häufig außerhalb unserer Vorstellungskraft liegen. Doch genau darin liege die Faszination. Außerdem wurden Perspektiven für die Entwicklung und einem zukünftigen Einsatz von Quantencomputern diskutiert.
Die wissenschaftliche Abendveranstaltung „Quantum Legacies: Grappling with Quantum Theory over a Turbulent Century“ fand im Magnus-Haus Berlin statt. Wissenschaftshistoriker David Kaiser erläuterte in seinem Festvortrag die Umstände und Kontexte der Physik im 20. Jahrhundert, die auch durch den kalten Krieg, Faschismus und nukleare Bedrohungen geprägt waren. Dabei legte er den Fokus auch auf das Zusammenspiel der Generationen, da damals besonders junge Physiker:innen – gerade Mitte zwanzig wie heutige Studierende und Promovierende – die Entwicklung der Quantenmechanik maßgeblich geprägt haben. Diese Veranstaltung stand unter der Schirmherrschaft des Fachverbands Geschichte der DPG und der Physikalischen Gesellschaft zu Berlin.
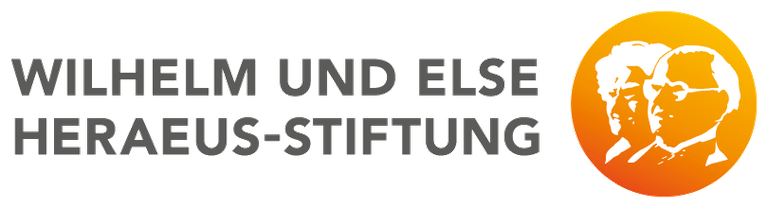
Zahlreiche Aktivitäten im nationalen Jubiläumsjahr werden durch die großzügige Unterstützung der Wilhelm und Else Heraeus-Stiftung ermöglicht.
